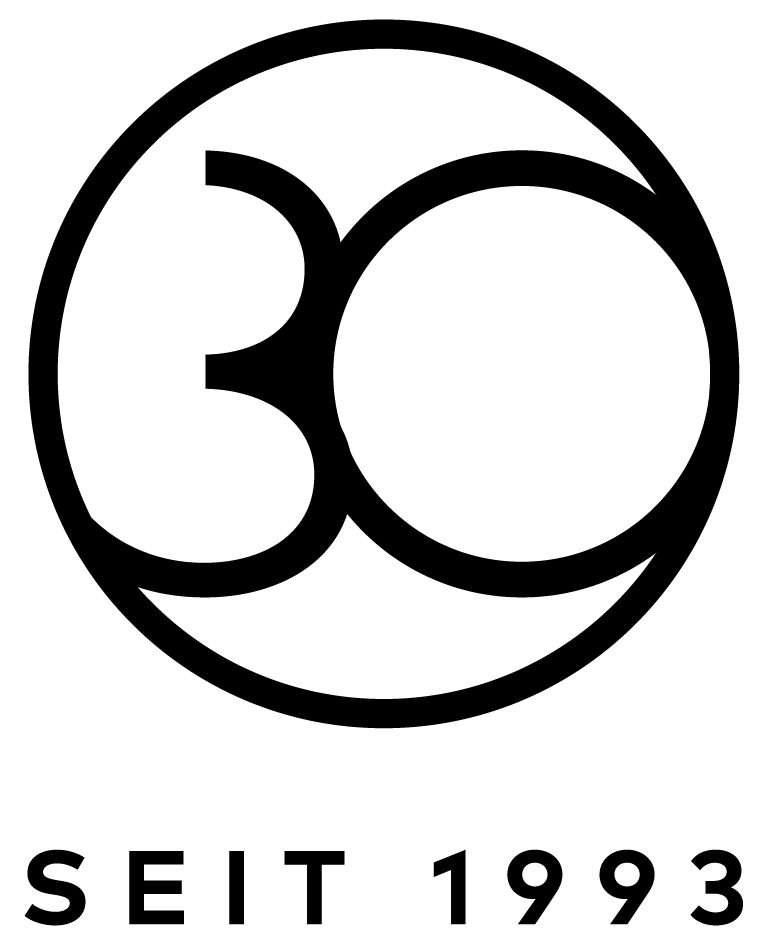Das Diversity-Management oder auch Management der Vielfalt genannt, ist ein Teilbereich des Personalmanagements. Im Diversity-Management wird versucht, die personelle und soziale Vielfalt der Mitarbeiter eines Unternehmens konstruktiv zu nutzen. Die Diversity der Belegschaft kann dabei über äußerliche Eigenschaften wie Behinderungen, ethnische Zugehörigkeiten oder auch Geschlecht und Alter definiert werden. Das Diversity-Management hat dabei nicht nur die Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund der besonderen Eigenschaften der Mitarbeiter zu verhindern und eine Chancengleichheit herzustellen. Diese Eigenschaften werden im Sinne der positiven Wertschätzung besonders hervorgehoben und es wird versucht, diese für den Erfolg des Unternehmens nutzbar zu machen.
Aufgaben des Diversity-Managements
Taylor Cox beschreibt die Aufgaben des Diversity-Managements als das Planen und Implementieren von organisatorischen Systemen und Praktiken. Dies soll dazu beitragen, die Mitarbeiter so zu managen, dass das Potenzial der Vorteile von Vielfältigkeit maximiert wird. Der Ansatz des Diversity-Managements steht also klassischen Betriebswirtschaftslehre entgegen. In den klassischen Ansätzen der Betriebswirtschaftslehre wird die Vielfältigkeit der Belegschaft nicht für die Gestaltungsprozesse des Unternehmens genutzt. Da die Vielfältigkeit hier nur einen von vielen Faktoren beschreibt. Beim Diversity-Management hingegen wird diese Diversität bewusst eingesetzt. Sie trägt dazu bei, diese bewusst im Sinne des Unternehmens zu gestalten. So kann das Diversity-Management dazu beitragen, ein größeres Rekrutierungspotenzial zu erschließen. Ebenfalls trägt es dazu bei, die Vielfalt der Kunden in der eigenen Organisation abbilden zu können. Dies kann die Identifikation der potenziellen Kunden mit dem Unternehmen steigern. Zusätzlich kann mit dem Diversity-Management gegen eine disfunktionale soziale Diskriminierung von Frauen und Minderheiten vorgegangen werden. Dadurch können auch unterrepräsentierte Gruppen einen Karriereweg in Führungspositionen finden. Dies steigert die Motivation, Wettbewerbsfähigkeit und Kreativität der Mitarbeiter. Das Nutzen des Potenzials der Mitarbeiter geht somit über das Aufgabenfeld der Mitarbeiterführung hinaus und verfolgt auch strategische Aufgaben für das Unternehmen.
Sie möchten mehr über Diversity-Management erfahren?