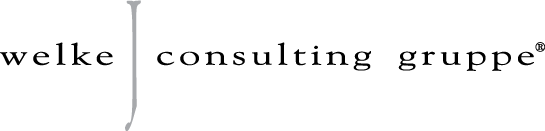
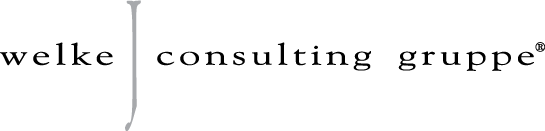
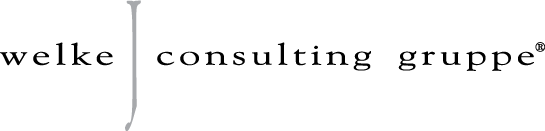
Im Grunde ist Digitalisierung bereits ein veralteter Begriff. Noch vor einigen Jahren sprach man über Digitalisierung und Big Data, heute sprechen wir über Smart Data, Künstliche Intelligenz, Blogchain, IoT oder über Vernetzung. Denn die Digitalisierung ist nicht einzeln zu sehen, sie betrifft uns alle, jeden Lebensbereich. Der Begriff der Digitalisierung kategorisiert all diese Unterthemen und schafft ein einheitliches Verständnis. Denn die Digitalisierung nimmt Auswirkungen auf Technologien, die Arbeitswelt, Geschäftsmodelle, Innovationen aber auch die Kommunikation – und zwar an jeder Stelle des Lebens. Digitalisierung wird heute in Schulen, bei Ärzten, in Familien und Vereinen diskutiert. Sie ist damit kein Gattungsbegriff mehr, über den sich diskutieren lässt – sie ist einfach da. Überall. Sie ist vernetzt.
Sie verschärft das soziale Ungleichgewicht (momentan insbesondere in den Diskussionen um Bildung zu sehen), sie fördert innovative Netzwerke und Kollaborationen. Daten werden zum neuen Öl. Die Konnektivität ist allgegenwärtig und stellt uns vor große Herausforderungen.
Aber sind Kinder, die ohne Zugang zu Rechnern und Internet während der Pandemie sozusagen vom Schulunterricht ausgeschlossen worden ein Problem der Digitalisierung? Was ist mit Selbstständigen, die ohne digitales Geschäftsmodell ( ➤ Geschäftsmodell entwickeln) in eine tiefe Krise fielen?
Nein, das alles sind keine Probleme der Digitalisierung. Digitalisierung kann die Lösung sein, aber es wird in Zukunft darum gehen, im Kollektiv eine Lösung für diese Probleme zu finden.
Was wir dafür brauchen? Kreativität.
Es geht nicht mehr darum, was wir denken, sondern wie wir denken. Fortschritt in Digitalisierungsfragen bringen uns nur unterschiedliche Denk- und Haltungsweisen. Viele Jahre waren wir erfolgreich, weil wir in Problem und Lösung dachten, weil wir gut darin waren, Dinge auszuengineeren, Dinge zu perfektionieren. Andere Länder gehen schon länger den Ansatz in Chancen und Entwicklung zu denken, nicht in Problemen. Doch das bedarf Kreativität und diese bedarf Vielfalt. Denn Technologie gibt nicht die Antwort. Sie beantwortet nicht die Frage, wie wir in Zukunft mit Technologie umgehen werden, denn Maschinen befolgen nur einfache Regeln. O-en und 1-sen, sie geben Antworten auf bereits gestellte Fragen, aber sie stellen nicht die Fragen. Raus kommt, was wir eingeben. So simple ist das.
6 von 10 Menschen würden sagen, dass Digitalisierung die Ausstattung mit Soft- und Hardware beschreibt, die Technik. Doch in Wahrheit ist auch die Digitalisierung zu 70 % durch den Menschen bestimmt und umfasst nur zu 30 % die Technologie. Es geht nicht darum das Rad neu zu erfinden, es geht darum, anders zu denken. Man hätte die Kerze weiter Perfektionieren können, aber man wäre nie zu elektrischem Licht gekommen. Professor Dr. Dirk Stein beschreibt die Digitalisierung. Er sagt: „Es geht darum, erfolgreich umgesetzte Konzepte zu nehmen und diese in einen völlig anderen Kontext einer gänzlich anderen Aufgabenstellung zu überführen und spezifisch anzupassen.“ Ziel muss es sein, zu schauen, was gut funktioniert und diese Ergebnisse sukzessive zu erweitern. Neue Lösungen zu schaffen, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht.
Menschen sind dumm, träge, langsam und Fehleranfällig. Zumindest, wenn man sie mit einem Computer vergleicht. Während der Mensch eine Rechenleistung von 500 Hz vorweisen kann, kann ein Leistungsstarker Computer das hundertausendfache davon leisten.
Warum? Weil sich der Mensch zu 99 % mit sich selbst beschäftigt.
Doch der Mensch hat dem Supercomputer eines Voraus: Er bricht Regeln. Wer nie Fehler macht oder andere Ideen zulässt, wird immer nur das tun, wofür er programmiert wurde. Der Mensch hingegen kann abstrahieren, Zusammenhänge verstehen, Dinge in einen anderen Kontext übersetzen. Je besser also der Input ist, den ein Computer erhält, desto besser werden seine Ergebnisse, so vielfältiger der Input ist, desto vielfältiger die Ergebnisse. Vielfalt ist also ein essenzieller Faktor, um das Zusammenspiel von Mensch und Maschine zu optimieren.
Es gilt Systeme zu durchbrechen, „outside the box“ zu denken. Unterschiedliche Teamzusammenstellungen, Netzwerke und Ideen erhöhen die Diversität und damit die kreative Spannung, das fördert neue Ideen. Selbst die besten Algorithmen und selbstlernenden Systeme können das heute nicht ersetzen, denn sie bleiben immer nur in dem Schema ihrer Programmierung. Selbstlernende Algorithmen werden in absehbarer Zeit, Ihre Systeme nicht verlassen können. Kreative Entschlüsse, ein „über den Tellerrand hinaus“ gibt es nur beim Menschen.
Zusammengefasst:
Diversität ist ein Katalysator für Innovation und Kreativität.
Komplexe Probleme brauchen komplexe Antworten.
Diverse Teams erleichtern interkulturelles Netzwerken.
Wenn Sie nun also über das nächste Digitalprojekt nachdenken: Finden Sie einen Anfang, lassen Sie Diversität zu und seien Sie geduldig. Vielfalt zuzulassen, bedeutet Verantwortung abzugeben. Veränderung braucht Zeit. Nehmen wir sie uns.